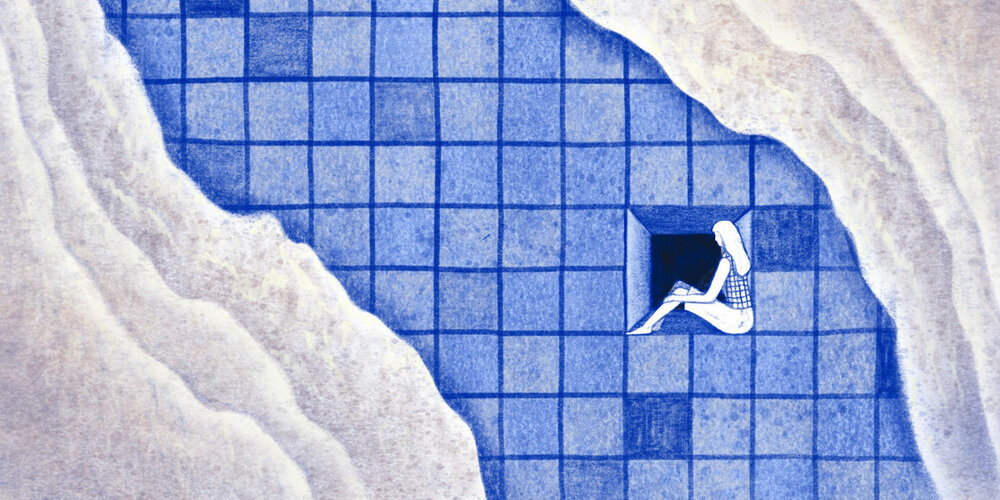Für viele war Covid nicht mehr als eine Grippe. Ebenso viele erachten die Pandemie als eine von Politik und Medien aufgebauschte Sache, als Hysterie. Für jene Menschen, die nach einer Ansteckung schwer an Long Covid erkrankt sind und bis heute mit den Folgen kämpfen, ist das blanker Hohn.
Keine Randgruppe
Es gibt in der Schweiz keine verlässlichen Zahlen über die diagnostizierten Long-Covid-Fälle. Bis heute gibt es keine Statistik und kein Register. Gemäss statistischen Untersuchungen in England geht man von ca. 3,5 % der Bevölkerung aus. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Covid Task Force sprechen mit Stand Januar 2023 von 20 % der infizierten Erwachsenen. Die Rede ist mal von 70'000, mal von 100'000, mal von 300'000. Klar ist: Es sind keine Einzelfälle. Zum Vergleich: In der Schweiz leben derzeit 15’200 von Multipler Sklerose (MS) Betroffene.
Was ist Long Covid?
Die WHO spricht von einer Post Covid-19-Erkrankung, wenn drei Hauptfaktoren gegeben sind: Wenn drei Monate nach einer bestätigten oder wahrscheinlichen Ansteckung mit dem Coronavirus Symptome bestehen, wenn die Symptome seit mindestens zwei Monaten andauern und wenn diese nicht durch eine andere Diagnose erklärt werden können.